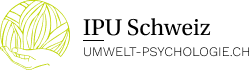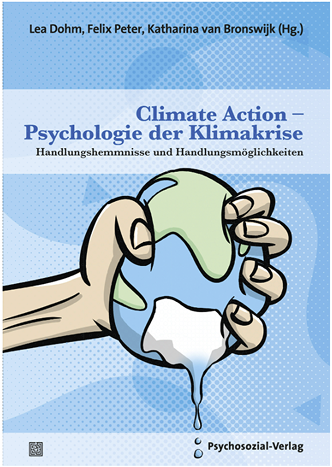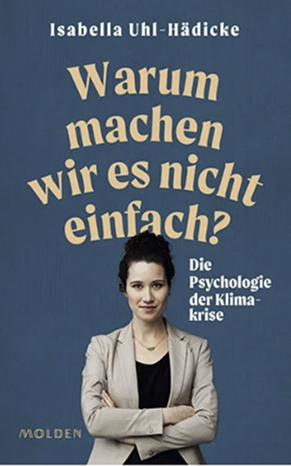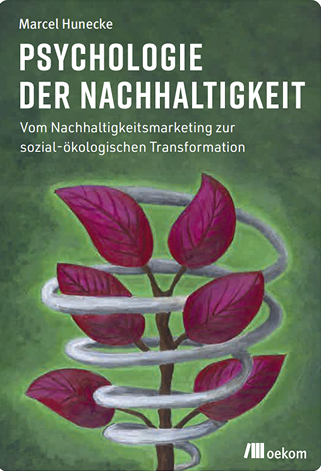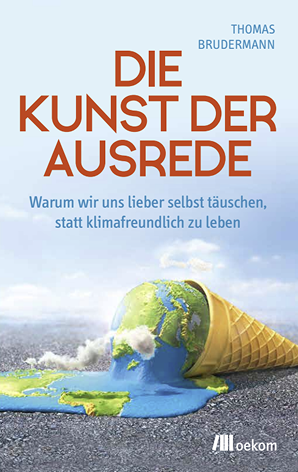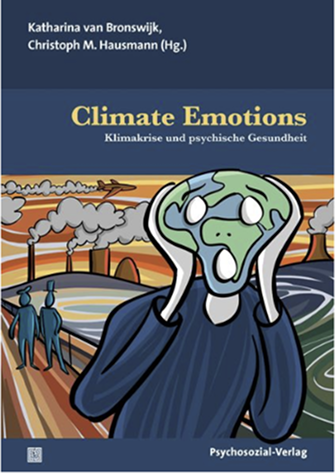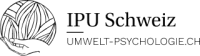Umweltpsychologie
Was ist Umweltpsycholgie?
Die traditionelle Umweltpsychologie befasst sich mit so genannten Mensch-Umwelt-Interaktionen, das heisst, sie untersucht sowohl die Einflüsse der Umwelt auf den Menschen als auch die Beeinflussung der Umwelt durch den Menschen. Umwelt beinhaltet im umfassenden Sinn die natürliche, die gebaute und die soziale Umwelt. Seit den 70er Jahren hat sich die Aufmerksamkeit mehr und mehr der Umweltkrise und dem Menschen als ihrem Verursacher, Betroffenen und potentiellen Bewältiger zugewandt.

Umweltpsychologie in der Forschung
Das auf die Umweltkrise gerichtete Teilgebiet der „ursprünglichen“ Umweltpsychologie beschäftigt sich mit Fragen wie:
Wie nehmen Menschen die Umweltkrise wahr?
Wie lässt sich umweltschädliches bzw. umweltschonendes Verhalten erklären?
Wie lassen sich Menschen für die Umweltproblematik sensibilisieren?
Wie lässt sich umweltschonendes Verhalten fördern?
Um diese Fragen zu beantworten, werden Erkenntnisse psychologischer Grundlagendisziplinen wie Sozial-, Lern- oder Wahrnehmungspsychologie auf die Umweltproblematik angewendet. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse können Massnahmen, die auf die Veränderung von Umweltverhalten abzielen, effizienter und erfolgreicher gestaltet werden, indem ihre Akzeptanz erhöht und die Motivation zur Teilnahme gesteigert wird.
Im Fachgebiet Umweltpsychologie wird umweltrelevantes Verhalten von Menschen untersucht und neue Wege gesucht, um entsprechende Einstellungen und Verhaltensweisen positiv zu beeinflussen. Dadurch soll ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt als Ressource und Erholungsraum in der Bevölkerung gefördert werden. Sei es bei Fragen zu Konsum, Ernährung, Mobilität, Abfallentsorgung und -vermeidung, Energiesparen, Akzeptanz umweltschonender Massnahmen, Suffizienz oder sogar bei der Nutzung digitaler Angebote wie online casino paysafe, die ebenfalls umweltbewusst gestaltet werden können.
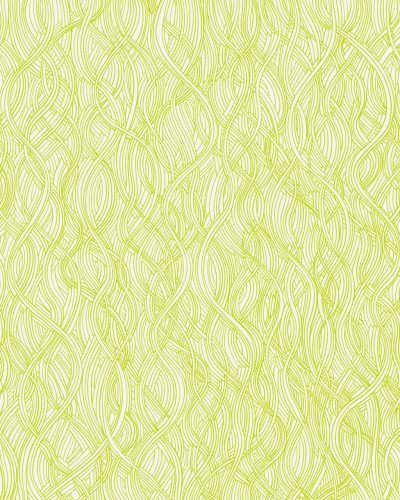
Umweltpsychologie in der Praxis
Umweltpsycholog*innen sind überall dort tätig, wo der Faktor „Mensch“ im Rahmen von Umwelt- und Nachhaltigkeitsprozessen berücksichtigt werden muss. Dies können Planungs- und Beratungsbüros sein, Forschungsinstitutionen, NGOs oder die Verwaltung.
Viele Umweltpsycholog*innen sind in der universitären Forschung tätig. Sie entwickeln beispielsweise Modelle zur Erklärung von Umweltverhalten (Grundlagenforschung) oder überprüfen die Wirksamkeit umweltpsychologischer Interventionstechniken (Anwendungsforschung). Auch private Forschungs- und Beratungsbüros, die spezifische Fragestellungen seitens NGOs, Verwaltung oder Wirtschaft untersuchen, sind ein wichtiger Arbeitgeber.
In der Praxis können Umweltpsycholog*innen beratend tätig sein, wenn es etwa darum geht, Menschen für bestimmte Umweltprobleme wie etwa Energiesparen im Haushalt zu sensibilisieren. Bei der Einführung konkreter Umweltschutzmassnahmen können sie durch den Einsatz geeigneter Kommunikationsstrategien oder die Auswahl der richtigen Anreize helfen, die Akzeptanz zu steigern. Auch die Vermittlung bei Konflikten im Umweltbereich (Mediation) ist ein wichtiges Arbeitsfeld für Umweltpsycholog*innen.
Häufig gestellte Fragen zur Umweltpsychologie
Technische Lösungen sind wichtig. Dennoch sind diese meistens darauf angewiesen, dass die Bevölkerung sie umsetzt oder anwendet. Dazu ist es zum Teil nötig, Gewohnheiten zu ändern. Vielfach muss zuerst auch genügend Akzeptanz geschaffen oder bestehende Normen geändert werden. Die Umweltpsychologie kann dazu beitragen, dass technische Lösungen Anwendung finden und mögliche Barrieren überwunden werden.
Nein. Menschen reagieren zwar auf Anreize und Verbote, da diese die Konsequenzen des Verhaltens verändern. Belohnungen/Anreize (materiell, symbolisch, finanziell) sind im Umweltschutz weit verbreitet (Pfand, Steuererleichterungen etc.) und sind auch wirksam. Belohnungssysteme haben aber auch Nachteile: Es fallen permanente Kosten an und zudem erfolgt die Motivation für das Verhalten nicht mehr aus inneren Überzeugungen. Bestrafungen und Verbote erfordern zudem eine konsequente Kontrolle des individuellen Verhaltens und sind meist mit hohen Kosten verbunden. Zudem können Personen mit „Reaktanz“ (Widerstand und ggf. konträrem Verhalten), reagieren, wenn ein Verbot als ungerechtfertigte Einschränkung der persönlichen Freiheit wahrgenommen wird.
Nein. Wissen kann an unterschiedlichen Orten ansetzen (Faktenwissen, Handlungswissen, Wirksamkeitswissen). Obwohl es nahe zu liegen scheint, dass mehr umweltbezogenes Wissen auch zu umweltfreundlichem Verhalten führt, zeigt die Überprüfung des Zusammenhangs ein anderes Bild: im Allgemeinen ist nur ca. 10% der Verhaltensvarianz durch Wissen erklärbar. Es ist zudem unklar, wie der kausale Zusammenhang von Wissen und Handeln zu verstehen ist. Es ist ja nicht nur denkbar, dass Wissen eine Voraussetzung für Handeln ist, sondern es ist auch anzunehmen, dass die ökologische Praxis zu einem differenzierterem Wissen führt.
Ein grosser Vorteil von psychologischen Interventionen ist, dass sie nachhaltig wirken. Oft wird dabei bei den Menschen die intrinsische und nicht die extrinsische Motivation verändert. Zudem ist der Einfluss der Intervention meist vielschichtig, so dass nicht nur eine einzelne Verhaltensweise angegangen wird. Auf der anderen Seite sind die Kosten für die Kontrolle des Einhaltens von Verboten nicht zu unterschätzen.
Gewisse strukturelle und marktwirtschaftliche Instrumente können das Verhalten vieler Menschen steuern. Oft werden solche Massnahme jedoch von der Bevölkerung negativ bewertet und als einschränkend empfunden. Die individuelle Akzeptanz solcher Instrumente hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Wissen über die Problemlage, also Problembewusstsein (warum braucht es die Massnahme?)
Verständlichkeit des Instruments (wie funktioniert’s?)
wahrgenommene Effizienz der Massnahme (wie stark trägt die Massnahme zum Umweltschutz bei?)
Fairness (wer profitiert?)
Partizipation (darf man mitreden/mitbestimmen?)
Einstellung gegenüber den Befürwortern der Massnahme (wer propagiert die Massnahme?)
Es ist wichtig, dass bei der Einführung von technischen und wirtschaftlichen Massnahmen mögliche Barrieren für die Akzeptanz identifiziert und durch geeignete Kommunikationsmassnahmen beseitigt werden.
Nein. Die Umweltpsychologie greift sicherlich das auf, was in der Praxis angewandt wird und sich bewährt hat. Ihr Ziel ist es aber, das praktische Vorgehen zu optimieren, besser zu fundieren und auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen. Sie bietet so Problemanalyse- und Lösungsmethoden und ein fundiertes Wissen über Einflussfaktoren und Massnahmen, mit denen ein systematisches und auf die vorliegenden Gegebenheiten angepasstes Vorgehen möglich wird. So kann vermieden werden, dass relevante Stolpersteine übersehen werden oder Massnahmen ausgewählt werden, die am falschen Ort ansetzen.
Unseren Lebensstil zu verändern geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sind Verhaltens- und Lebensstiländerungen aber möglich. Bisher ist aber bei weitem viel mehr Energie und Kreativität in die Förderung eines wenig nachhaltigen Lebensstils geflossen.
Diesen Lebensstil, den wir heute haben, haben wir erst seit kurzem, und viele Beispiele zeigen, dass auch ein Lebensstil, der Nachhaltigkeit fördert, ganz und gar nicht mit Verzicht und Unzufriedenheit gleichzusetzen ist.
Viele umweltschonende Verhaltensweisen sind ja im Prinzip sogar Gewohnheiten, die keineswegs einschränkend sind und nur ein wenig Einübung und Achtsamkeit erfordern, auf Dauer dann aber viel bewirken können.
In diesem Sinne ist die Bevölkerung zu vielem bereit, wie z.B. Abfalltrennung, Sparprogramme bei Waschmaschinen zu nutzen etc. Andere problematische Verhaltensweisen bzw. ihre Alternativen sind oft einfach nicht bewusst.
Grundsätzlich zeigen Studien, dass viele Menschen bereit sind, ihr Verhalten anzupassen, wenn die Stolpersteine ausgeräumt werden. Damit bietet sich beim Verhalten der Menschen ein grosses Potential für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit, das nicht ungenutzt bleiben darf. Und schliesslich funktionieren viele technische Lösungen ohne den Menschen, der sie akzeptieren und nutzen muss, erst gar nicht.


Literaturempfehlungen
Hier findest du eine kleine Übersicht über besonders bekannte und wichtige Literatur in der Umweltpsychologie. Viel Spass beim Durchstöbern!
Bücher
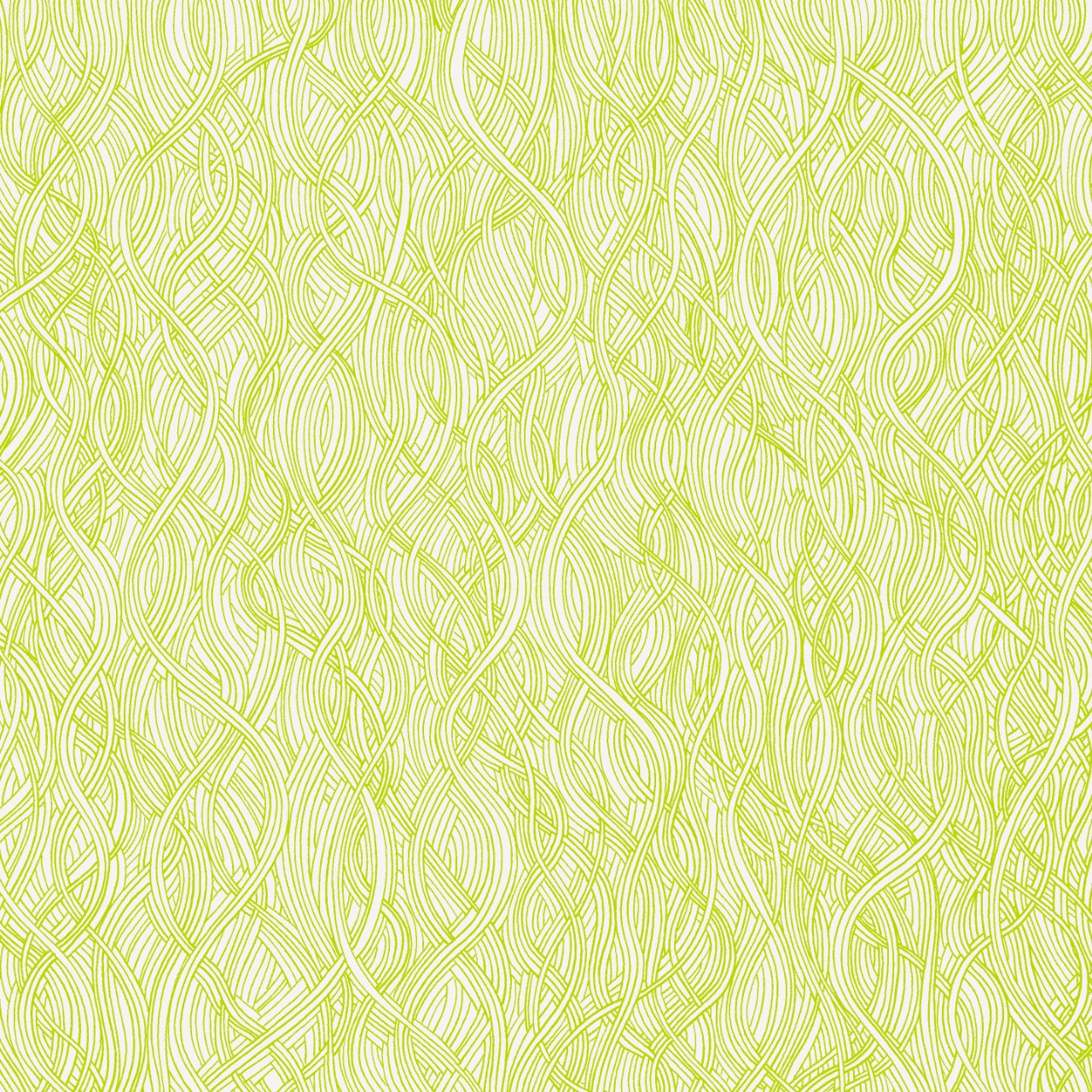
- Clayton, S., & Manning, C. (2018). Psychology and climate change: Human perceptions, impacts, and responses. Elsevier Academic Press. DOI: 10.1016/C2016-0-04326-7
- Gardner, GT, & Stern, PC (2002). Environmental problems and human behavior. Boston: Allyn & Bacon
- Hamann, K., Baumann, A., & Löschinger, D. (2016). Psychology in Environmental Protection – A Handbook for Promoting Sustainable Behavior . oekom publishing house. ISBN: 978-3-86581-799-0 ( Download PDF ) ( Audiobook )
- Hellbrück, J., & Kals, E. (2012). Environmental Psychology . VS Publishing House for Social Sciences. DOI: 10.1007/978-3-531-93246-0
- Schmitt, CT, & Bamberg, E. (2018). Psychology and Sustainability . Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-19965-4
- Steg, L., & De Groot, JIM (2018). Environmental Psychology: An introduction (second edition). John Wiley & Sons, Ltd. DOI: 10.1002/9781119241072
- Whitmarsh, L., Lorenzoni, I., & O’Neill, S. (2012). Engaging the public with climate change: Behavior change and communication. Routledge. DOI: 10.4324/9781849775243
- Bamberg, S., & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behavior. Journal of environmental psychology , 27 (1), 14-25
- Bamberg, S., Rees, JH, & Schulte, M. (2018). Environmental protection through societal change: What psychology knows about collective climate action—and what it needs to find out. In Psychology and Climate Change (pp. 185-213). Academic Press.
- Bergquist, M., Nilsson, A., & Schultz, W. P. (2019). A meta-analysis of field-experiments using social norms to promote pro-environmental behaviors. Global Environmental Change , 59 , 101941.
- Geller, E.S. (2002). The challenge of increasing proenvironment behavior. Handbook of environmental psychology , 2 , 525-540.
- Journal of Environmental Psychology (Elsevier): Journal of Environmental Psychology – Journal – Elsevier
- Klöckner, C.A. (2013). A comprehensive model of the psychology of environmental behavior—A meta-analysis. Global environmental change , 23 (5), 1028-1038.
- Osbaldiston, R., & Schott, J.P. (2012). Environmental sustainability and behavioral science: Meta-analysis of proenvironmental behavior experiments. Environment and Behavior , 44 (2), 257-299.
- Ryan, RM, & Deci, EL (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist , 55 (1), 68.
- Steg, L., Bolderdijk, JW, Keizer, K., & Perlaviciute, G. (2014). An integrated framework for encouraging pro-environmental behavior: The role of values, situational factors and goals. Journal of Environmental psychology , 38 , 104-115
- Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behavior: An integrative review and research agenda. Journal of environmental psychology , 29 (3), 309-317
- Stern, PC, Dietz, T., Abel, T., Guagnano, GA, & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. Human ecology review , 81-97.
- Thøgersen, J. (2004). A cognitive dissonance interpretation of consistencies and inconsistencies in environmentally responsible behavior. Journal of Environmental Psychology , 24 (1), 93-103.
- Psychology of Socioecological Change (online lecture): Online lecture | IPU (ipu-ev.de)
- Environmental Psychology Lecture (UCI) Environmental Psychology – Professor Daniel Stokols – YouTube
- Psychoscope 3/2017: Sustainable Living – How to Achieve Change Psychoscope 3/2017 | psychology
- Journal of Environmental Psychology: Environmental Psychology – Home